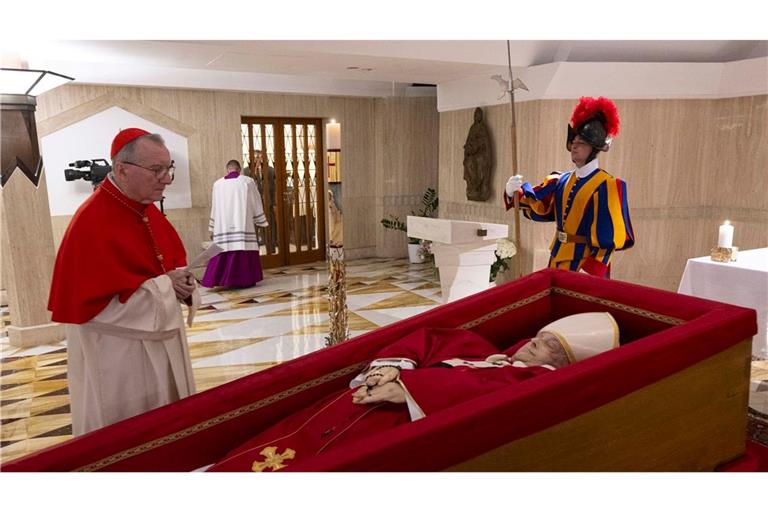Clans müssen um ihre Millionen fürchten
Neue Zahlen zu Vermögen aus Straftaten in Deutschland – Gesetzesverschärfung entfaltet Wirkung
Kriminalität - Die Behörden haben zuletzt immer wieder Vermögen aus kriminellen Quellen einkassiert. Möglich macht dies eine Gesetzesänderung, die allerdings rechtlich umstritten ist.
Berlin Im Kampf gegen organisierte Kriminalität und verbrecherische Clans haben die Behörden zuletzt zunehmend hohe Millionenwerte einkassiert: Allein 77 Immobilien im Besitz einer arabischen Großfamilie wurden in Berlin im vergangenen Sommer vorläufig beschlagnahmt. In Zukunft dürften Staatsanwaltschaften immer häufiger zum Mittel der sogenannten Vermögensabschöpfung greifen.
Nachdem die Justizbehörden dem Treiben krimineller Großfamilien jahrelang scheinbar machtlos gegenüberstanden, bekamen sie Mitte 2017 durch eine Gesetzesänderung ein scharfes Schwert an die Hand, das sie nun zunehmend führen: Seitdem können Richter eine Abschöpfung von Bargeld, Immobilien, Luxusautos oder Aktien bereits beschließen, wenn sie überzeugt davon sind, dass diese aus kriminellen Machenschaften stammen. Einer konkreten Tat müssen die Vermögenswerte dafür nicht zugeordnet werden.
Allein 2017 wurden in Deutschland Vermögen im Wert von fast 647 Millionen Euro vorläufig sichergestellt. Knapp 200 Millionen Euro wurden auf richterlichen Beschluss eingezogen. Das geht aus einer Aufstellung des Bundesjustizministeriums hervor, die von der FDP-Bundestagsfraktion angefordert wurde und unserer Zeitung vorliegt. Nicht unterschieden wird darin, wie sich die Zahlen nach dem Inkrafttreten der Verschärfung am 1. Juli 2017 verändert haben.
An der Spitze der Aufstellung vorläufig beschlagnahmter Vermögen liegt Bayern mit mehr als 307 Millionen Euro. Dahinter folgen Nordrhein-Westfalen mit fast 184 Millionen, Hessen mit 55 Millionen und Baden-Württemberg mit mehr als 34 Millionen. Das auch als Clan-Hauptstadt geltende Berlin hat mit 28 Millionen Euro im Jahr 2017 den fünfthöchsten Vermögenswert aus mutmaßlich kriminellen Quellen beschlagnahmt. Allein der Stadtstaat Bremen konnte in dem Jahr keine sichergestellten Vermögen vermelden.
In der Rangliste der von Gerichten eingezogenen Vermögen liegt Schleswig-Holstein an der Spitze mit 59 Millionen. Dahinter folgen Nordrhein-Westfalen (32 Millionen), Berlin (28 Millionen) und Bayern (22 Millionen). In Baden-Württemberg ordneten die Gerichte den Einzug von Vermögen aus mutmaßlich trüben Quellen in Höhe von zwölf Millionen Euro an.
Bundesweite Zahlen für das vergangene Jahr liegen dem Bundesjustizministerium noch nicht vor. Die Summen dürften jedoch steigen, wie das Beispiel aus Berlin zeigt. Die dort über das gesamte Stadtgebiet im Sommer 2018 beschlagnahmten 77 Immobilien sollen einen Wert von zusammen mehr als neun Millionen Euro haben.
Das Bundesjustizministerium ist auf jeden Fall zufrieden mit der Reform der Vermögensabschöpfung: Diese habe „insbesondere mit Blick auf Terrorismus und organisierte Kriminalität“ ein Instrument geschaffen, das die „Abschöpfungslücke“ für kriminell angehäufte Vermögen aus „unklarer Herkunft“ schließe, heißt es in der Antwort auf die FDP-Anfrage. Auch für den FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle zeigen die Zahlen, dass die Reform einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität leiste.
Doch der Bundestagsabgeordnete hat auch Bedenken: „Die Regelung ist verfassungsrechtlich auf Kante genäht“, sagte Kuhle unserer Zeitung. Schließlich habe der Bundesgerichtshof bereits erkennen lassen, dass er die neue Regelung hinsichtlich verjährter Taten für verfassungswidrig halte. Der studierte Jurist sieht es zudem kritisch, dass die Reform praktisch zu einer Umkehr der Beweislast führe, wodurch der Betroffene die Rechtmäßigkeit seines Vermögens nachweisen muss.
„Polizei und Staatsanwaltschaft brauchen für ihre Arbeit aber Rechtssicherheit“, sagte Kuhle. Die Bundesregierung müsse deswegen erklären, wie sie sich die rechtssichere Zukunft der Vermögensabschöpfung vorstelle. Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität dürfe außerdem nicht bei der Vermögensabschöpfung enden. „Die Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern muss verbessert werden“, forderte der FDP-Innenexperte.