Alarmierender Bericht
Bis 2050 drohen Millionen Tote durch Klimawandel
Die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels sind vielfach analysiert. Doch was passiert mit der globalen Gesundheit, wenn Temperaturen steigen und Wetterextreme zunehmen? Das Weltwirtschaftsforum in Davos wagt ein Szenario.
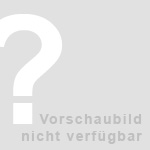
© Pervez Masih/AP/dpa
Opfer von Überschwemmungen durch Monsunregen tragen Habseligkeiten aus ihrem überfluteten Haus in der pakistanischen Provinz Sindh.
Von Markus Brauer/dpa
Durch den Klimawandel drohen in den kommenden Jahrzehnten einer Bericht zufolge mehrere Millionen Todesfälle, außerdem schwere Krankheiten und hohe Kosten für die Gesundheitssysteme.
Das größte Risiko geht dabei von Überschwemmungen aus. Zu diesem Schluss kommt der am Dienstag (16. Januar) in Davos vorgelegte Report „Folgen des Klimawandels für die globale Gesundheit“ des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum) und des Beratungsunternehmens Oliver Wyman.
When Climate Impacts Your Health with Bill Anderson (@Bayer), @bishen_shyam, @VictorDzau (@theNAMedicine), @VBKerry (@Seed_Global), Cheryl Moore (@wellcometrust) and @nisia_trindade (@minsaude) #wef24https://t.co/t6tPGdS2ZL — World Economic Forum (@wef) January 16, 2024
Die Folgen des Klimawandels
Die Studienautoren betrachten sechs zentrale Klimawandel-Folgen: Überschwemmungen
Szenario des Weltklimarats
Zugrunde liegt das mittlere Szenario des Weltklimarats (IPCC) zum Temperaturanstieg bis zum Jahr 2100. Angenommen wird dabei unter anderem ein Anstieg der Durchschnittstemperatur um 2,7 Grad Celsius.
Der IPCC hat in seinem rund 4000 Seiten langen Berichtsentwurf zahlreiche Auswirkungen der Erderwärmung auf den Menschen, aber auch auf die Natur zusammengetragen. Den Forschungsergebnissen zufolge, welche die IPCC-Experten gesammelt und ausgewertet haben, bringt der Klimawandel weite Teile der Erde mit zahlreichen Tieren und Pflanzen in Gefahr.
Welche Gefahren das sind, sehen Sie in unserer Bildergalerie.
Kosten für Klimawandel gehen in die Billionen
Bis zum Jahr 2050 könnte der Klimawandel dann laut Studie weltweit bis zu 14,5 Millionen Todesfälle verursachen. Allein de Gesundheitssysteme müssten zusätzliche Kosten in Höhe von 1,1 Billionen US-Dollar (1,01 Billionen Euro) tragen.
Die Gesamtkosten des Klimawandels könnten einer Prognose zufolge in den kommenden Jahrzehnten sogar noch deutlich höher sein. Im Jahr 2070 könnten sie weltweit bereits 5,4 Billionen US-Dollar (umgerechnet rund 4,6 Billionen Euro) betragen, wie Forscher des University College London und der Nichtregierungsorganisation Carbon Disclosure Projekt (CDP) berechneten.
Zum Ende des nächsten Jahrhunderts, im Jahr 2200, könnten sie sogar die Schwelle von mehr als 30 Billionen US-Dollar (mehr als 26 Billionen Euro) erreichen, weil etwa Naturkatastrophen zu immer verheerenderen Schäden führen dürften. Zugrunde liegt dieser Berechnung ein „Weiter-wie-bisher“-Szenario mit einem ähnlichen Ausstoß von Treibhausgasen, das bis zum Ende dieses Jahrhunderts zu einer Erderwärmung von 4,4 Grad führen würde.
Die Folgen von Überschwemmungen
Allein Überschwemmungen könnten den Schätzungen zufolge bis 2050 für 8,5 Millionen Tote sorgen: Nicht nur direkt, sondern auch indirekt durch Ernteschäden, vermehrte Infektionskrankheiten und eine höhere Luftfeuchtigkeit, die zu Atemwegserkrankungen führen kann. Besonders betroffen wäre der asiatisch-pazifische Raum mit seinen stark bevölkerten Küstenregionen.
Die Folgen von Dürren
Die zweithöchste Sterberate mit 3,2 Millionen Toten erwarten die Autoren durch Dürren: vor allem wegen langfristiger Auswirkungen von sinkender Wasserqualität und weniger fruchtbaren Böden etwa auf die Kindersterblichkeit. Hitzewellen könnten demnach bis 2050 rund 1,6 Millionen Leben kosten, vor allem bei älteren Menschen.
Die Folgen durch Krankheitserreger
Dazu kämen der Bericht zufolge vermehrte Krankheiten und Fälle von Berufsunfähigkeit. Bei wärmeren Temperaturen etwa könnten sich Mücken deutlich ausbreiten, so dass Malaria, Dengue-Fieber und Zika-Infektionen auch in Europa und den USA gängiger würden.
Insgesamt aber wären der Studie zufolge besonders Regionen in Afrika, Mittleren Osten und Asien von den gesundheitlichen Folgen des Klimawandels betroffen. Anders als auf die Corona-Pandemie könnten sich Regierungen und die weltweite Gesundheitsbranche auf diese Entwicklung aber vorbereiten, betonen die Studienautoren.
Die Ergebnisse des Berichts sollen am Donnerstag (19. Januar) auch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos diskutiert werden.

© Monika Skolimowska/dpa
Luftverschmutzung: Rauch und Wasserdampf steigen aus den Schornsteinen und Kühltürmen im Kohlekraftwerk Laziska bei Kattowitz in Polen.
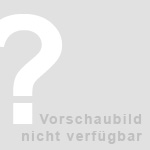
© Marwan Naamani/dpa
Umweltverschmutzung: Viele Ökosysteme an Land, an Küsten, im Süßwasser und im Meer befinden sich derzeit „nahe oder jenseits“ der Grenze ihrer Fähigkeit, sich an Umweltveränderungen wie die Erderwärmung anzupassen, schreiben die Autoren des neuen IPCC-Berichts (Bild: Plastikmüll liegt an einem Strand am Mittelmeer nördlich von Beirut. Der Müll wurde durch stark windiges Wetter hier angeschwemmt).
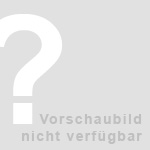
© Arne Dedert/dpa
Waldsterben: Zunehmende extreme Umweltereignisse in Kombination mit langfristigen Klimaentwicklungen bringen Ökosysteme an sogenannte Kipp-Punkte. Bei Überschreiten dieser Kipp-Punkte sind dem Berichtsentwurf zufolge „abrupte und womöglich irreversible Veränderungen“ zu befürchten (Bild: Abgestorbene Fichten ragen in einem Waldstück bei Balkhausen im Odenwald in die Höhe).
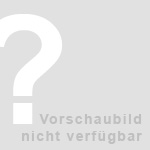
© Felipe Dana/AP/dpa
Eisschmelze: Die Fläche des Arktischen Ozeans, die auch im Sommer mit Eis bedeckt ist, ist seit Ende der 1970er Jahre um ein Viertel geschrumpft (Bild: Ein kleines Boot schwimmt inmitten eines Eisbergfeldes im grönländischen Kulusuk. Grönland ist besonders vom Klimawandel betroffen).
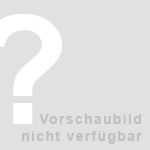
© Christian Sommer/FAU/dpa
Gletscherschmelze: Durch das Auftauen der seit Jahrtausenden gefrorenen Böden könnten riesige Mengen darin gespeicherten Kohlendioxids freigesetzt werden, was wiederum die Erderwärmung weiter beschleunigen würde. Alle Erderwärmungsszenarien legen den bevorstehenden Verlust der Permafrostböden nahe (Bild: Der Klimawandel lässt die Gletscher – wie hier den Aletschgletscher in der Schweiz – in den Alpen schwinden).

© Julian Stratenschulte/dpa
Landwirtschaft: Bei einer Erderwärmung um zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter rechnen die IPCC-Wissenschaftler mit einem Verlust von 15 Prozent der Permafrostböden bis zum Jahr 2100. Dabei würden demnach zwischen 36 und 67 Milliarden Tonnen CO2 freigesetzt (Bild: Ein Landwirt erntet Kartoffeln auf einem staubtrockenen Feld in der Region Hannover).

© Liv Andrew Walmsley/Liverpool John Moores University via PA Media/dpa
Artensterben: Das Tempo beim Aussterben von Arten hat sich massiv beschleunigt. Schätzungen zufolge ist es tausend Mal höher als vor dem Antropzän, dem erdgeschichtlichen Zeitalter des Menschen (Bild: Ein männlicher Tapanuli-Orang-Utan hängt in einem Baum).
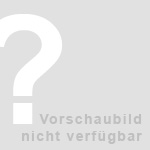
© Dita Alangkara/AP/dpa
Meere: Bei einer Erderwärmung von zwei bis drei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter werden laut IPCC bis zu 54 Prozent der weltweiten Arten an Land und im Wasser im Laufe dieses Jahrhunderts vom Aussterben bedroht sein (Bild: Fische schwimmen an einem Korallenriff vor der Komodo-Insel in Indonesien).
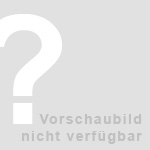
© Ulf Mauder/dpa
Artensterben: Schon bei einer Zwei-Grad-Erderwärmung sind die Tierarten der Polarregionen wie Eisbären, Robben und Pinguine bedroht, dasselbe gilt für die Bewohner artenreicher Ökosysteme wie Korallenriffe und Mangrovenwälder (Bild: Ein Eisbär steht im Nordpolarmeer auf einer Eisscholle).
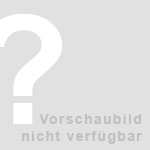
© Joe Mwihia/AP/dpa
Artensterben: Wegen steigender Temperaturen wandern Pflanzen und Tiere aus ihren angestammten Lebensräumen ab. Die Grenzen der Ökosysteme werden sich noch in diesem Jahrhundert voraussichtlich um hunderte Kilometer verschieben (Bild: Gnus durchqueren während ihrer jährlichen Wanderung vom Serengeti Nationalpark in Tansania in das Masai Mara Naturschutzgebiet in Kenia ein Gewässer).

© Pablo Ovalle Isasmendi/Agencia Uno/dpa
Dürren: Die Zunahme von Temperaturen, Trockenheit und Dürren hat die Länge der Waldbrand-Phasen erhöht und die Feuer-gefährdete Fläche verdoppelt (Bild: Die Überreste eines toten Fisches liegen auf dem Boden in einem trockenen Gebiet des Peñuelas Sees im chilenischen Valparaiso).
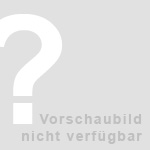
© Diego Baravelli/dpa
Versteppung: Es wird damit gerechnet, dass sich die Wahrscheinlichkeit für schwerwiegende Dürren in natürlichen Gebieten Brasiliens bei einer Erderwärmung um zwei Grad vervierfacht. Bei hohen Treibhausgasemissionen könnten Dürren und Waldbrände die Hälfte des Amazonas-Regenwaldes in Grasland verwandeln. (Bild: Luftblick auf den Wald im Amazonas nahe Sao Gabriel da Cachoeira).

© Ringo H.W. Chiu/FR170512 AP/dpa
Waldbrände: Dies wäre ein Kipp-Punkt, an dem große Mengen Kohlendioxid zusätzlich freigesetzt würden und der globale Treibhausgasausstoß damit substanziell erhöht würde (Bild: Ein Feuerwehrmann beobachtet, wie Rauch von einem Buschfeuer in Kalifornien aufsteigt)
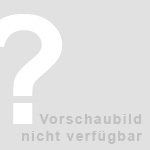
© Uncredited/RU-RTR Russian Television/AP/dpa
Waldbrände: In der arktischen Tundra und in den Wäldern im Norden waren Waldbrände früher ungewöhnlich. Von 1996 bis 2015 hat sich die durch Brände zerstörte Fläche in Sibirien aber verneunfacht (Bild: Waldbrand in der russischen Republik Sacha).
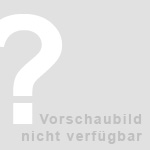
© Uncredited/Kyodo News via AP/dpa
Meeresfauna: Selbst wenn das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens erreicht wird, rechnen die Experten mit dem Absterben von 70 bis 90 Prozent der Korallenriffe, die Lebensraum für viele Arten sind (Bild: Great Barrier Riff in Australien).
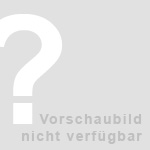
© K. C. Alfred/ZUMA Wire/dpa
Meereserwärmung: Hitzewellen in den Meeren, die Schäden an Korallenriffen, Seetang-Wäldern und Seegras-Wiesen anrichten oder sie zerstören können, haben zwischen 1925 und 2016 um 34 Prozent zugenommen. Ihre durchschnittliche Dauer nahm im gleichen Zeitraum um 17 Prozent zu (Bild: Eine Welle bricht, während die Sonne am Windansea Beach in der Gemeinde La Jolla in San Diego untergeht).



