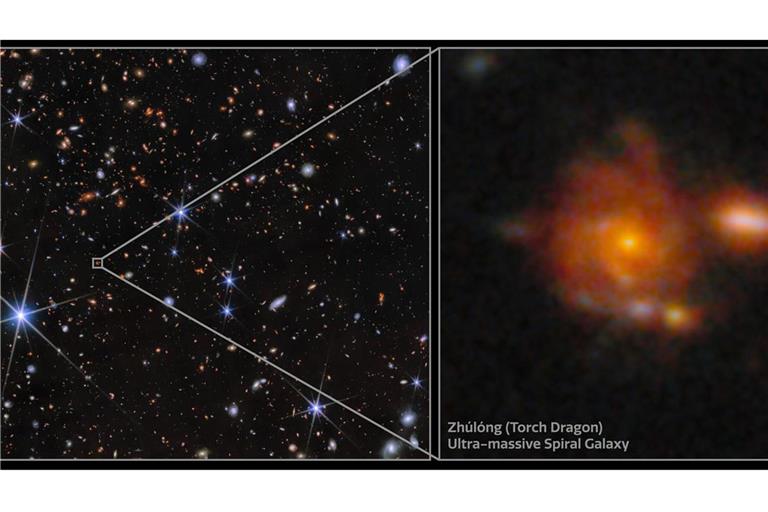Fünf Jahre Corona
„Die Politik hat sich hinter der Wissenschaft versteckt
Fünf Jahre nach dem ersten Corona-Fall in Deutschland spricht die Sprachwissenschaftlerin Sina Lautenschläger im Interview über das Vertrauen in die Forschung und die Wissenvermittlungsprobleme.

© dpa/Jane Barlow
Bei Medizinforschung bestehen stets Gefahren – etwa auch jene, dass Wissenschaftler von Laien missverstanden werden.
Von Werner Ludwig
Die Sprachwissenschaftlerin Sina Lautenschläger hat die Wissenschaftskommunikation während der Coronapandemie untersucht. Sie plädiert für einen offenen Umgang mit ungeklärten Forschungsfragen.
Corona hat Virologen über Nacht aus ihren Labors in die Talkshows katapultiert. Oft wurden sie auch für unpopuläre Entscheidungen verantwortlich gemacht. Waren sie darauf vorbereitet?
Nicht so ganz. Zu Beginn der Pandemie standen in Talkshows und Pressekonferenzen zwar wissenschaftliche Aspekte im Fokus – etwa die Frage, wie so ein Virus aufgebaut ist oder wie es sich verbreitet. Doch mit der Zeit sind diese Fragen in den Hintergrund gerückt. Stattdessen sollten Forschende Empfehlungen dazu abgeben, ob Schulschließungen oder andere Maßnahmen sinnvoll sind oder nicht. Das sind aber am Ende keine virologischen, sondern politische Entscheidungen.
Wurden Forschende von der Politik instrumentalisiert?
Durchaus. Studien wurden aus dem Zusammenhang gerissen und von Politikern und Politikerinnen zur Stützung ihrer eigenen Positionen benutzt – teils bevor die Ergebnisse von der Fach-Community begutachtet worden waren. Eine Pandemie, in der auf Basis einer oft unsicheren Datenlage schnelle Entscheidungen getroffen werden mussten, war natürlich eine besondere Herausforderung. Doch häufig hat sich die Politik hinter der Wissenschaft versteckt. Wenn es Kritik am Zickzackkurs der Corona-Maßnahmen gab, wurde mit dem Finger auf die Fachleute gezeigt. Politik und Wissenschaft funktionieren eben nach unterschiedlichen Regeln. Politiker und Politikerinnen wollen bei der Wählerschaft gut ankommen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen wissen, wie Dinge funktionieren.
Wie hat sich die Pandemie auf das Vertrauen in die Wissenschaft ausgewirkt?
Laut dem Wissenschaftsbarometer ist das Vertrauen zu Beginn der Pandemie gestiegen. Es gab ja auch einen großen Erklärungsbedarf. Die Bedrohung durch das Virus war sehr konkret. Zudem waren viele von Lockdowns und anderen Einschränkungen betroffen. Teilweise fühlten sich Bürgerinnen und Bürger der Wissenschaft aber auch ein Stück weit ausgeliefert. Das hat in Teilen der Bevölkerung die Frage aufgeworfen, von wem wir eigentlich regiert werden und stellenweise zu wachsender Wissenschaftsskepsis geführt – bis hin zur Querdenkerbewegung und absurden Verschwörungstheorien.
Ein Kritikpunkt war, dass sich die Einschätzungen der Fachleute immer wieder mal geändert haben – etwa mit Blick auf Masken.
Bis heute unterliegen manche dem Missverständnis, dass Wissenschaft unumstößliche Gewissheiten hervorbringt. Aber wenn neue Daten vorliegen, müssen Erkenntnisse und Einschätzungen revidiert werden. Und nicht alle Forschenden sind immer gleich einer Meinung. In der Pandemie haben manche Medien solche Unterschiede in den Vordergrund gerückt – und etwa zum Virologenstreit zwischen Christian Drosten und Hendrik Streeck hochstilisiert. Diese Art der Personalisierung, verbunden mit kurzen Schlagzeilen, in denen die Dinge sehr unterkomplex dargestellt werden, verspricht eben höhere Einschaltquoten und Klickzahlen.
Wie sollten Forschende in ihrer Kommunikation mit wissenschaftlichen Unsicherheiten umgehen?
Es führt kein Weg daran vorbei, Wissenslücken klar zu benennen. Das mag für manche Zuhörerinnen und Zuhörer verwirrend sein, ist aber essenziell für die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft. Während der Pandemie haben die Fachleute das im Prinzip richtig gemacht: Sie haben immer wieder darauf hingewiesen, dass ihre Einschätzungen auf dem jeweils aktuellen Forschungsstand beruhen und sich auch wieder ändern können.
Sie kritisieren die Personalisierung und Emotionalisierung in Teilen der Medien. Was bedeutet das für Forschende, die die Öffentlichkeit sachlich informieren wollen?
Sie müssen sich gut überlegen, wo und in welchen Formaten sie sich äußern. Niemand ist zum Beispiel gezwungen, zu Markus Lanz zu gehen oder der Bild-Zeitung ein Interview zu geben. Auf der anderen Seite hat etwa die Virologin Melanie Brinkmann gesagt, dass sie während der Pandemie in Talkshows gegangen sei, weil sie damit so viele Menschen erreichen konnte. Aber in solchen Formaten geht es nicht um wissenschaftliche Komplexität, sondern um knappe Statements. Hinterher wird man oft hart kritisiert. Man muss abwägen, ob man das in Kauf nehmen will.
In der Pandemie wurde teilweise auch das Privatleben der Fachleute thematisiert, um deren Kompetenz in Frage zu stellen.
Da ist vieles vermischt worden – und darauf waren einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht gut vorbereitet. Ich habe aber den Eindruck, dass viele Forschende daraus gelernt haben und sich heute genauer überlegen, wie sie sich öffentlich äußern. Wichtig ist es auch, die Grenzen seiner Expertise klar zu benennen und zum Beispiel zu sagen: Ich bin Virologin und kann daher nichts zu den psychischen Folgen des Lockdowns sagen.
Die Pandemie hat die Wissenschaftskommunikation enorm beschleunigt. Beinahe täglich wurden Preprint-Studien publiziert, die noch nicht von Fachleuten beurteilt worden waren. Führt das nicht leicht zu Missverständnissen?
In der Wissenschaft gibt es eine funktionierende Selbstkontrolle. Wenn eine Studie mit fragwürdigen Ergebnissen publiziert wird, bleibt das in der Fachwelt nicht unbemerkt. Einige Wochen später erscheint dann eben ein Artikel, der auf Unstimmigkeiten und Fehler hinweist. Deshalb ist es wichtig, sich nicht nur auf einzelne Studien zu berufen, sondern den gesamten Forschungsstand zu berücksichtigen.
Wie verändern soziale Medien die Wissenschaftskommunikation?
X und Co. folgen einer anderen Logik als klassischen Medien. Forschende können dort zwar sehr viele Menschen erreichen und etwa auf neue Studien verweisen. Komplexe Zusammenhänge lassen sich aber nur sehr begrenzt vermitteln. Zudem kann jede x-beliebige Privatperson irgendeinen Kommentar zu den Posts der Forschenden abgeben. Darauf muss man gefasst sein.
Expertin für Kommunikation
Linguistin Sina Lautenschläger ist promovierte Sprachwissenschaftlerin. An der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist sie als Koordinatorin der Arbeitsstelle für linguistische Gesellschaftsforschung tätig. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehört neben Schweigen in digitaler Kommunikation und Sprachkritik auch die Wissenschaftskommunikation.
Forschung In einem von der Klaus Tschira Stiftung geförderten Projekt untersuchte sie von 2020-2023 gemeinsam mit Kolleginnen der TU Darmstadt das Spannungsfeld Wissenschaft, Politik und Medien während der Corona-Pandemie.