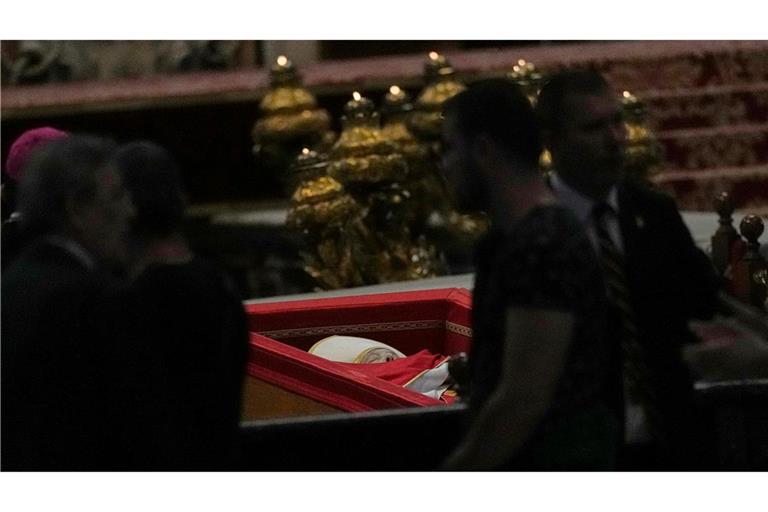Kunst im Kanzleramt
Entlastungspaket vor wilden Augen
Die Pressekonferenz der Bundesregierung zum Entlastungspaket geriet am Sonntag zum Hörspiel. Die Kameras konzentrieren sich auf das Geschehen dahinter: „Augenbilder“ von Ernst-Wilhelm Nay.

© dpa/Michael Kappeler
Bundeskanzler Scholz (2. v. links) vor Ernst-Wilhelm Nays „Augenbilder“-Mitteltafel
Von Nikolai B. Forstbauer
Als müde, aber erfolgreiche Matadore betreten sie am Sonntagvormittag den Presse- und Informationssaal der Bundesregierung im zweiten Stock des Berliner Kanzleramtes: Die Spitze der Bundesregierung um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) präsentiert das dritte Entlastungspaket für die von Inflation und rasanten Energiepreissteigerungen gebeutelten Bürgerinnen und Bürger. Die Kameras zoomen die Szenerie heran und wählen doch überraschende Perspektiven. Hinter dem Kanzler scheint Wildes im Gang, tiefgelbe Farbbahnen schlingen sich ineinander und lassen doch Raum für etwas, das die Kameras zunächst nur ahnen lassen. Ein schwarzes Auge? Noch eines? Sind wir als Beobachterinnen und Beobachter der Szenerie gar die Beobachteten?
Die „Augenbilder“ hingen unter der Decke
Die Lösung: Der Kanzler sitzt vor dem Mittelteil eines dreiteiligen Kunstwerks. Und „Augenbilder“ ist tatsächlich auch der Titel des Triptychons des Malers Ernst-Wilhelm Nay (1902-1968). Das Besondere: Die Bilder sind für die Weltkunstausstellung Documenta III, 1964 in Kassel, entstanden. Auf Initiative von Documenta-Gründer Arnold Bode malte Nay, in den späten 1950er Jahren mit Farbkreisbildern zu den wichtigsten deutschen Künstlerinnen und Künstlern der gegenstandslosen Malerei aufgestiegen, drei neue Bilder, die hoch unter die Decke des Museums Fridericianum gehängt wurden. Als ob sie aus den Farbwirbeln auftauchen würden, schauten die Augen auf die Besucherströme herab. Höllenblicke aus der Höhe.
Nur einmal noch sind die „Augenbilder“ zu sehen wie einst für Kassel geplant – 2009 wird das Werk für eine große Nay-Ausstellung im Frankfurter Städel Museum erneut als Blick von oben präsentiert. Längst haben Nay-Bilder wie jede einzelne der drei Tafeln, die im Kanzleramt ihren ständigen Ort gefunden haben, bei Auktionen die Millionengrenze durchbrochen. An diesem Sonntag aber scheinen die Bilder ganz frisch, kehren sie kraftvoll die Verhältnisse um, bringen sich förmlich in Stellung.
Harte Kritik von Zeitgenossen
Ernst-Wilhelm Nay hätte sich über die die Szenerie sicher gefreut. Umso mehr, als ihn sein Rückgriff auf Urformen menschlicher Figuration nicht vor harten Attacken aus der jüngeren Künstlerschaft rettete. So schrieb etwa Hans Platschek am 4. 9. 1964 in der Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“: „Offensichtlich ist, dass Nay Segenssprüche hervorruft und das, was er malt, auf den Händen getragen, anstatt an die Wand gehängt und angeschaut wird.“ Und Klaus-Jürgen Fischer schrieb gar am 5. 11. 1964 im Berliner „Tagesspiegel“ mit Blick auf Nay: „Je verworrener mythisch-expressiv ein Bild im farbigen, formalen und technischen Aufbau, desto mehr Chancen hat es, von deutschen Kunstauguren als potent und bedeutend betrachtet zu werden.“
Für den Berliner Galeristen Klaus-Gerrit Friese, Spezialist für die deutsche Nachkriegsmoderne, ist indes die offenkundige Begeisterung der Kameraleute und der Fotografinnen und Fotografen nur zu gut zu verstehen: „Diese irrlichternden Augen, die uns beobachten und die wie unser staunendes Ich zugleich sind“, sagt Friese am Sonntag unserer Zeitung, „die autonomes Kunstwerk sind und gesellschaftliche Verhältnisse beschreiben: Das macht uns auch fast 60 Jahre nach ihrem Entstehen nachdenklich“. Und Friese greift noch weiter: „Der späte alte, gar nicht weise und immer noch wilde Nay, dessen Bilder Aufbruch signalisierten, ist heute da wie eh und je und liefert uns einen stetigen Kommentar zu allen Zeitläuften, die das Bild Tag für Tag erlebt.“
Mahnung, wachsam zu bleiben
Und auch der Kunsthistoriker Günter Baumann, Partner in der Stuttgarter Galerie Schlichtenmaier, hebt auf die Aktualität von Nays Bildern im Kanzleramt ab: „Die späten Augenbilder von Ernst Wilhelm Nay“, sagt Baumann unserer Zeitung, „sind von einer monumentalen Wucht, die heute noch so atemberaubend ist wie vor fast 60 Jahren“. Und auch er erinnert an die Diskussionen von 1964: „Damals, auf der Documenta III“, so Baumann, „war das dreiteilige Werk der große Aufreger, weil es angeblich allzu dekorativ wäre. Angesichts der heutigen Krise der Kasseler Mega-Schau war das rückblickend wohl eine Scheindebatte“. Und er fügt hinzu: „Mich faszinieren diese Arbeiten, die im Bundeskanzleramt hängen, wegen ihrer mythisch-symbolischen Präsenz – Argusaugen, die ganz aus der Abstraktion hervordrängen, als Mahnungen, wachsam zu bleiben in einer wehrhaften Demokratie“.
Nay in Kürze
Leben 1902 geboren in Berlin, absolviert Ernst-Wilhelm Nay nach dem Abitur 1921 zunächst eine Buchhandelslehre. Neben Gelegenheitsjobs entstehen erste malerische Versuche. 1924 bis 1928 studiert Nay, gefördert von Karl Hofer, Malerei in Berlin. 1930 bekommt er auf der dänischen Insel Bornholm ein erstes Stipendium, 1931 erhält er das begehrte Villa-Massimo-Stipendium in Rom. Mit finanzieller Unterstützung durch Edvard Munch gelingt 1937 eine Reise nach Norwegen, es entstehen die „Lofoten“-Bilder. 1942 dient er der Wehrmacht als militärischer Kartenzeichner in Frankreich. 1945 bis 1949 entstehen die „Hekate“-Bilder, 1949 bis 1951 und verbunden mit dem Umzug nach Köln der Zyklus „Fugale Bilder“. 1952 bis 1953 malt Nay die Serie „Rhythmische Bilder“, 1954 beginnt mit den „Scheibenbildern“ der berühmteste Zyklus. 1955 erscheint Nays Manifest „Vom Gestaltwert der Farbe“. 1955, 1959 und 1964 ist er auf der Documenta in Kassel präsent, 1956 vertritt Nay zudem Deutschland auf der Biennale in Venedig. 1963 bis 1964 entstehen die „Augenbilder“, 1965 bis 1968 der Zyklus „Späte Bilder“ 1968 stirbt Ernst-Wilhelm Nay in Köln.
Werk Der Kunsthistoriker Günter Baumann notiert: „Ernst Wilhelm Nay hat maßgeblich dazu beigetragen, die Moderne in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zu etablieren. In den Jahren nach 1945 löst sich Nay aus dem Einfluss des Surrealismus und des Expressionismus. 1950 wächst die Autonomie der Farbformen, das Gegenständliche verschwindet vollständig aus seinen Bildern. Nay findet zur Farbe, die nichts mehr bedeutet außer sich selbst, die als reiner Gestaltwert von allen gegenständlichen Bezügen gereinigt ist. In seinen ab 1951 entstehenden ,Rhythmischen Bildern’ setzt er die Farbe als reinen Gestaltwert ein. Seit 1955 entstehen seine ,Scheibenbilder’, in denen runde Farbflächen subtile Raum- und Farbmodulationen im Bild organisieren. Nays lebenslanges Anliegen ist es, das ,Elementarbild’ zu schaffen, alle Rhythmik und Dynamik durch die Farbe, der elementarsten Darstellung, zu erreichen.“