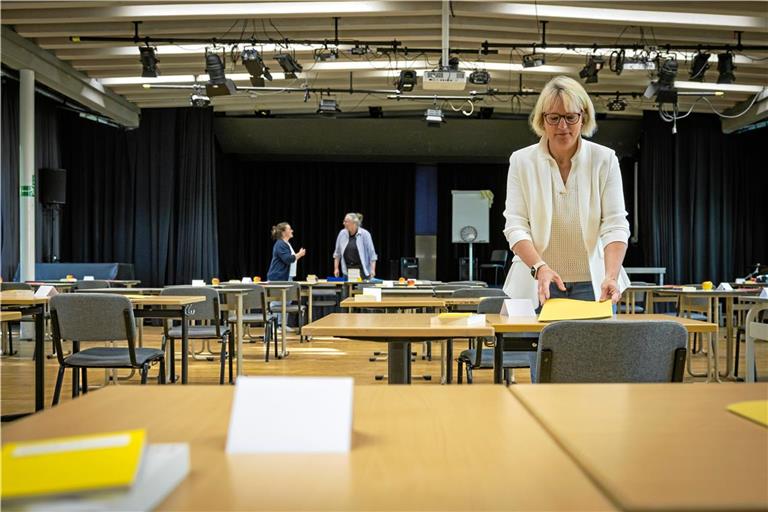Kläranlage Neuschöntal ein Sanierungsfall
Laut einem Gutachten muss die Stadt in den nächsten Jahren mindestens 19 Millionen Euro in die marode Anlage investieren. Die Backnanger Bevölkerung muss sich deshalb auf steigende Abwassergebühren einstellen.

© Alexander Becher
Im Belebungsbecken wird Druckluft ins Abwasser gepumpt, um die Bakterien, die das Wasser reinigen, mit Sauerstoff zu versorgen. In Neuschöntal funktioniert diese Technik zwar noch, sie verbraucht aber viel mehr Energie als bei modernen Anlagen. Fotos: Alexander Becher
Von Kornelius Fritz
Backnang. Wohin das Abwasser fließt, wenn man bei der Toilette die Spülung drückt oder in der Badewanne den Stöpsel zieht, darüber machen sich die wenigsten Gedanken. Städte und Gemeinden sind hingegen gezwungen, sich intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen, denn die Abwasserentsorgung gehört zu den Pflichtaufgaben jeder Kommune. Die Stadt Backnang betreibt momentan noch drei Kläranlagen, will die beiden kleineren in Sachsenweiler und Horbach aber bis 2025 aufgeben (wir berichteten). Dann wird das Abwasser aus fast allen Backnanger Haushalten nach Neuschöntal fließen.
Allerdings ist auch diese Kläranlage in schlechtem Zustand, wie das Gutachten eines Ingenieurbüros zeigt, das kürzlich im Betriebsausschuss Stadtentwässerung vorgestellt wurde. Die Experten des Ingenieurbüros Holinger aus Merklingen hatten sich die Kläranlage, deren ältester Teil aus dem Jahr 1979 stammt, genau angeschaut und eine lange Mängelliste erstellt. Von den technischen Anlagen entspreche kaum noch eine dem heutigen Stand der Technik, bemerkte Ingenieur Martin Wett.
Die mechanischen Rechen seien zu grob, die Klärbecken nicht tief genug und die Schaltanlage so alt, dass man keine Ersatzteile mehr dafür bekomme. Auch die Betriebsgebäude seien marode. Die Gutachter empfehlen der Stadt deshalb eine umfassende Sanierung der Kläranlage in drei Abschnitten. Die Gesamtkosten beziffern sie auf 19,2 Millionen Euro, wobei diese Schätzung auf den heutigen Preisen beruht. Da die Experten von einer Bauzeit von insgesamt acht Jahren ausgehen, könnte es angesichts der stark steigenden Baukosten also noch deutlich teurer werden.
Während der Bauzeit mussdie Anlage immer in Betrieb bleiben
„Ist denn überhaupt noch irgendwas an der Anlage okay?“, wollte Stadtrat Gerhard Ketterer (CDU) nach dieser ernüchternden Bestandsaufnahme wissen. „Die Anlage läuft noch“, entgegnete Wett, allerdings empfehle sein Büro, rund 80 Prozent der Anlagentechnik bis 2030 zu ersetzen. Denn gegenüber einer modernen Kläranlage habe Neuschöntal viele Nachteile. Nicht nur die Klärleistung sei deutlich schlechter, die Anlage verbrauche auch wesentlich mehr Energie. So ließe sich etwa der Strombedarf für die Gebläse, die Sauerstoff in die Belebungsbecken pumpen (siehe Infobox) glatt halbieren, rechnete der Experte vor.

© Alexander Becher
Die technischen Anlagen, wie diese Filterpresse, muten schon fast historisch an. Teile der Kläranlage in Neuschöntal stammen aus dem Jahr 1979.
Trotz der gewaltigen Investitionssumme sieht man im Rathaus keine vernünftige Alternative zur vorgeschlagenen Generalsanierung: „Wir müssen es machen. Da führt kein Weg dran vorbei“, erklärte Erster Bürgermeister Siegfried Janocha im Ausschuss. Dass die Sanierung so teuer und langwierig wird, liegt laut Baudezernent Stefan Setzer auch daran, dass die Kläranlage durchgehend in Betrieb bleiben muss. Ein Neubau an anderer Stelle würde wahrscheinlich schneller gehen, aber das scheitert schon an der Standortfrage.
Bezahlen müssen das Ganze letztlich alle Backnanger Bürgerinnen und Bürger über ihre Abwassergebühren. Wie stark diese steigen werden, könne er im Moment aber noch nicht beziffern, sagt Tiefbauamtsleiter Lars Kaltenleitner, der auch den städtischen Eigenbetrieb Stadtentwässerung leitet.
Heinz Franke (SPD) äußerte im Ausschuss die Befürchtung, dass die sanierte Kläranlage die künftigen Anforderungen womöglich trotzdem nicht erfüllen werde: „Dann müssen wir vielleicht permanent nachbessern.“ Diese Sorge hält Gutachter Martin Wett aber für unbegründet. Die heutigen Grenzwerte würden auf jeden Fall eingehalten; und sollte der Gesetzgeber seine Vorgaben verschärfen, sei es auch kein Problem, die Anlage später noch um eine vierte Reinigungsstufe zu erweitern.
Mechanische Klärung Eine Rechenanlage entfernt zunächst alle groben Verunreinigungen wie Toilettenpapier, Hygieneartikel und Essensreste. Anschließend fließt das Wasser durch den den sogenannten Sandfang. Dort setzen sich Sand und andere grobe mineralische Verunreinigungen am Boden ab. In einem Vorklärbecken wird die Strömungsgeschwindigkeit dann so weit reduziert, dass sich auch kleinere Schlammteilchen absetzen. Diese werden vom
Boden des Beckens abgepumpt, ebenso Fett und andere Stoffe, die an der Wasseroberfläche schwimmen.
Biologische Klärung Das vorgeklärte Abwasser wird in das sogenannte Belebungsbecken gepumpt. Bakterien und andere Mikroorganismen bauen dort organische Stoffe wie Phosphate und Stickstoffverbindungen ab, die im Wasser gelöst sind. Da sie dafür Sauerstoff benötigen, wird über ein Gebläse Druckluft in das Becken geblasen.
Nachklärung Im Nachklärbecken setzen sich die Bakterien als Flocken auf dem Boden ab. Sie werden dann zum Teil wieder in das Belebungsbecken zurückgepumpt.
Klärschlammbehandlung Der Schlamm, der in einer Kläranlage anfällt, wird in einen Faulturm gepumpt. Dort wird er unter Luftabschluss für 21 Tage auf eine Temperatur von 37 Grad erwärmt und dabei regelmäßig umgewälzt. Spezielle Bakterien zersetzen in dieser Zeit die organischen Substanzen. Dabei wird ein Klärgas gebildet, das überwiegend aus Methan besteht und zur Stromerzeugung verwendet werden kann. Der ausgefaulte Schlamm wird anschließend mit Zentrifugen entwässert und entsorgt.