Union und SPD nach der Wahl
Wo Schwarz-Rot sich einigen könnte – und wo Streit droht
Die potenziellen Koalitionspartner Union und SPD haben sich im Wahlkampf an vielen Stellen festgelegt, wie sie mit der Wirtschaft umgehen wollen. Auf wesentlichen Feldern dürfte der Konsens schwer fallen. Doch es gibt auch verbindende Punkte.
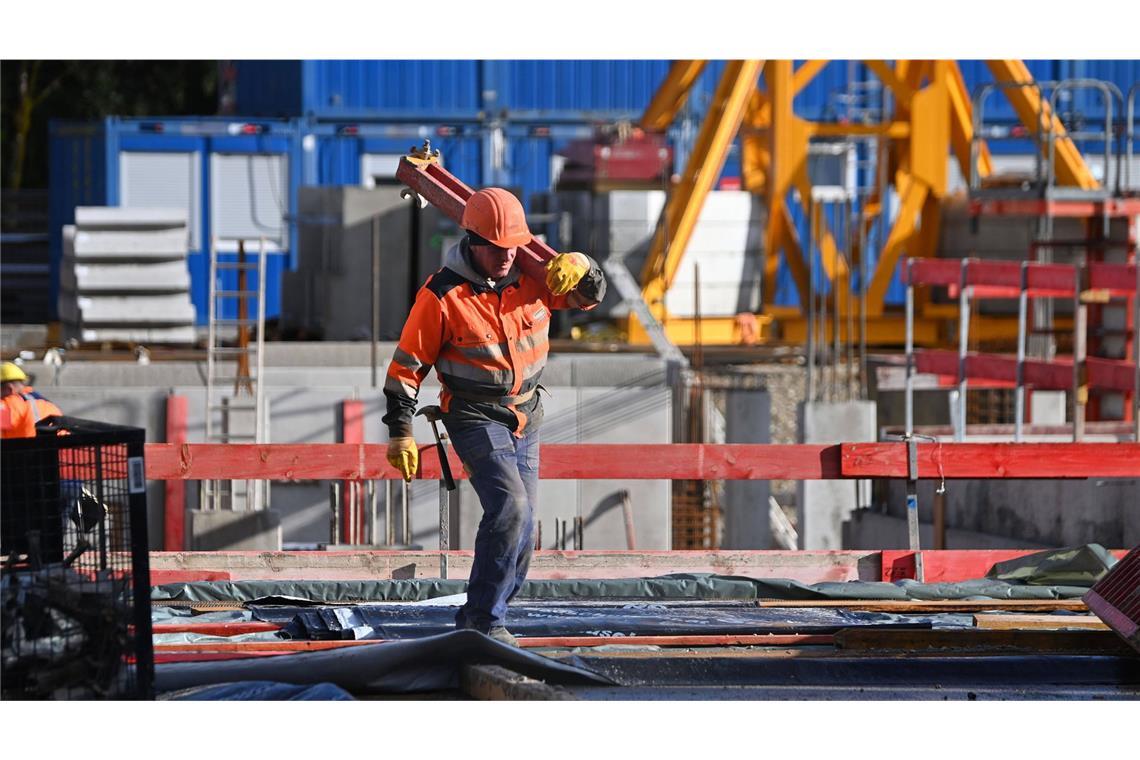
© Imago/Sven Simon
Auf Investitionen – unter anderem in den Wohnungsbau – hofft die Wirtschaft von der neuen Regierung.
Von Matthias Schiermeyer
Die Wirtschaft drückt aufs Tempo, keine Stellungnahme nach der Bundestagswahl kommt ohne Mahnung an Union und SPD aus, sich rasch zu einigen. Dafür sind große Gräben zu überwinden. Wo liegen die größten Konfliktpunkte in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, wo sind klare Fortschritte aus Unternehmenssicht denkbar? Ein Überblick.
Konsenschance 1: Investitionsoffensive Der Investitionsstau ist immens – die Infrastruktur muss bei Verkehr und digitalen Netzen, Wohnungsbau und Schulen gestärkt werden. Die SPD hat für eine gezielte Wirtschaftsförderung mit Prämien für Industrie und Mittelstand geworben. Mit Hilfe eines „Made in Germany“-Bonus’ sollen Unternehmen in Ausrüstungsinfrastruktur wie etwa Maschinen investieren.
Da könnten CDU/CSU womöglich mitgehen. Weil sich diese Ausgaben aus dem laufenden Haushalt aber nicht bezahlen lassen, geht damit die Forderung nach einer Reform der Schuldenbremse einher. Nachdem die Union deren Lockerung zunächst strikt abgelehnt hatte, signalisierte der designierte Kanzler Friedrich Merz zuletzt Beweglichkeit an der Stelle. Sollte aber ein schuldenfinanzierter Infrastrukturinvestitionsfonds aufgelegt werden, bräuchte Schwarz-Rot eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag.
Konsenschance 2: Energiepreise Viele energieintensive Unternehmen sind in existenzielle Nöte geraten. Um eine verstärkte finanzielle Unterstützung dürfte die künftige Koalition nicht herumkommen. Möglich ist zum Beispiel, dass – wie die Union verspricht – Stromsteuer und Netzentgelte gesenkt werden, um den Strom schnell und spürbar günstiger zu machen. Dies würde dann alle begünstigen.
Die Union will auch das sogenannte Heizungsgesetz abschaffen. Kanzler Olaf Scholz hatte dieses Grünen-Projekt seinerseits kritisiert. Insofern könnte es an der Stelle mehr Technologieoffenheit geben.
Konsenschance 3: Bürokratieabbau Die Forderung nach Entbürokratisierung ist Bestandteil fast jeder Politikerrede. Somit hatten sich CDU/CSU „Entrümpelungsgesetze und Bürokratie-Checks“ vorgenommen. Auf diesem Feld scheint am ehesten eine Verständigung möglich – zumal die Beseitigung von Dokumentations- und Berichtspflichten den Staat kein Geld kostet.
Der Teufel steckt im Detail: Dass das nationale Lieferkettengesetz – Sinnbild der Bürokratiebelastung – abgeschafft wird, ist eher unwahrscheinlich; zumal die EU-Lieferketten-Richtlinie ohnehin bis Juli 2026 in nationales Recht überführt werden muss. Das schon in der Schublade liegende Tariftreuegesetz wird vor diesem Hintergrund womöglich auch nicht einigungsfähig sein.
Konfliktfeld 1: Steuern Beim Thema Steuern prallen die Fronten direkt aufeinander. Die Union hat im Wahlkampf die klare Ansage gemacht, dass die steuerliche Belastung der Unternehmen auf maximal 25 Prozent gesenkt, der Rest-Soli abgeschafft sowie Abschreibungsmöglichkeiten verbessert werden sollen.
Die SPD hat sich strikt gegen „Steuergeschenke für die Reichen“ gewehrt und lehnt eine Steuersenkung mit der Gießkanne ab. Stattdessen wünscht sie eine Neugewichtung der Steuern, indem Einkommen aus Arbeit entlastet und Spitzenvermögen stärker belastet werden. Diese beiden Pole scheinen zunächst unvereinbar zu sein.
Konfliktfeld 2: Bürgergeld Kontroversen drohen auch im Bereich der Sozialpolitik: Die Union will das maßgeblich von der SPD eingeführte Bürgergeld wieder abschaffen und durch eine neue „Grundsicherung“ ersetzen. Damit sollen mehr Anreize gesetzt werden, eine Arbeit aufzunehmen. Olaf Scholz hat zwar ebenso Unverständnis über „Totalverweigerer“ geäußert und vorgeschlagen, Betroffenen öffentlich geförderte Jobangebote zu machen. Doch radikale Leistungskürzungen wird die SPD nicht mitmachen – aus der prinzipiellen Befürchtung heraus, dass das sozialdemokratische Profil dann gänzlich verloren geht.
Konfliktfeld 3: Arbeitswelt Einen gesetzlichen Mindestlohn von 15 Euro pro Stunde hat die SPD im Wahlkampf versprochen. Würde die Union da mitgehen, wäre ein Sturm der Entrüstung in der Wirtschaft die Folge. Es ist daher möglich, dass die nächste Koalition die Verantwortung gänzlich der von den Sozialpartnern besetzten Mindestlohnkommission überlässt.
Eine langjährige Forderung der Wirtschaftsverbände ist die Modernisierung des Arbeitszeitrechts: Für alle Unternehmen soll anstelle der täglichen eine wöchentliche Höchstarbeitszeit gelten. Die Union hat diese Forderung übernommen. Für die SPD ist die Ausgestaltung der Arbeitszeit ein Kernbestandteil der Tarifautonomie. Danach sollen die Sozialpartner flexibel auf die Bedürfnisse der Beschäftigten reagieren können. Die Interessen der Gewerkschaften zu unterlaufen, dürfte den Genossen schwer fallen.



