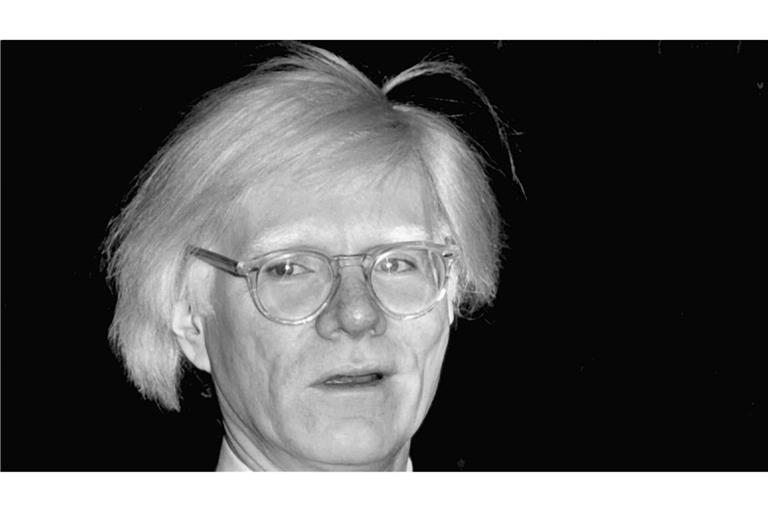Darf man das? Oh ja!
Die Bonner Bundeskunsthalle zeigt die Ausstellung „Michael Jackson: On the Wall“
Ausstellung - Nur wenige Tage nach den neuen Missbrauchsvorwürfen gegen Michael Jackson eröffnet die Bundeskunsthalle in Bonn eine Schau über den Superstar. Sie liefert kluge Denkanstöße zur Frage, wie weit man Künstler und Werk trennen kann.
Rein Wolfs hat ein Problem, aber er geht erstaunlich souverän damit um. „Die Diskussion geht uns an“, sagt der Intendant der Bundeskunsthalle über die – wie bei so großen Ausstellungen üblich – lange im Voraus geplante aktuelle Schau seines Hauses. Die ist urplötzlich durch den Dokumentarfilm „Leaving Neverland“ und die darin erhobenen Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Michael Jackson vorab ins Zwielicht gerückt worden.
Die Vorwürfe betrachte seine Institution natürlich als „schockierend“. Dennoch stellt der Niederländer über die von der Londoner National Portrait Gallery konzipierte und zuletzt in Paris gezeigte Schau „On the Wall“ klar: „Dies ist keine Hommageausstellung, sondern Ergebnis der Realität, wie Menschen mit dem Phänomen Michael Jackson umgehen.“
Plausibel wird Rein Wolfs Haltung, allen Rufen nach einer Absage der Ausstellung entschieden entgegenzutreten, durch einen bedenkenswerten, von ihm wie folgt aufgestellten logischen Schluss: „Wir zeigen eine rezeptionsästhetische Ausstellung über ein Massenphänomen, bei diesem Phänomen kommen Werk und Mensch zu einem Gesamtkunstwerk zusammen.“ Daraus folge, dass man „bei der Betrachtung dieses Gesamtkunstwerks die Werke und den Künstler nicht trennen kann“.
Das eigentliche Argument für die Sinnhaftigkeit und Legitimität dieser Ausstellung liefern jedoch die Exponate. 53 Künstler sind mit 134 Arbeiten versammelt, die grundverschiedene Blicke auf Michael Jackson werfen und so vielleicht den enigmatischen Sänger besser zu entschlüsseln helfen. Ganz gewiss jedoch erhellen sie den Zwiespalt zwischen Jahrhundertkünstler und Sonderling.
Manches des Gezeigten ist jenseits der Kitschgrenze, wie Kehinde Wileys Monumentalgemälde des hoch zu Ross sitzenden Jackson, das einem Gemälde Rubens’ nachempfunden ist und als Auftragsarbeit für den Musiker entstand, was allein schon ein bezeichnendes Licht auf den Auftraggeber wirft. Manche Künstler liefern gewitzte Paraphrasen auf den Kitsch, etwa Paul McCarthy, der Jeff Koons’ groteske Porzellanskulptur „Michael Jackson and Bubbles“ zu einer noch überdrehteren Form persifliert.
Andere Arbeiten hingegen sind von verblüffender Schlüssigkeit, etwa eine performative Videoinstallation von Candice Breitz. In der singen sechzehn echte Jackson-Fans dessen Erfolgsalbum „Thriller“ a cappella so nach, dass sich nicht Fremdscham einstellt, sondern Respekt vor diesem Meisterwerk. Die Künstlerin Isa Gentzken wiederum, der man künstlerische Ernsthaftigkeit gewiss nicht absprechen will, setzt im Begleittext zu den von ihr gezeigten Arbeiten dem formelhaften Jargon und den ästhetisierenden Mechanismen des Kunstbetriebs den flotten Satz „Jasper Johns interessiert mich nicht so besonders, aber Michael Jackson liebe ich total“ entgegen.
Es ist ein buntes Kaleidoskop auch der künstlerischen Techniken, das diese sehenswerte Ausstellung vorführt, teils mit sehr hoher inhaltlicher Qualität. Thematisch stringent sind die Exponate auf zehn Räume verteilt, löblicherweise denken sie immer wieder auch die afroamerikanische Perspektive mit. Wenngleich man fragen darf, wie weit der zuletzt fast erbleichte und in einem goldenen Käfig in selbst gewählter Isolation lebende Superstar noch für die Black Community und eine afroamerikanische Identität stand. Wie man sich in dieser Ausstellung ohnehin oft fragen darf, was bei diesem Musiker noch mit dem Welterfolg, was nur noch mit Größenwahn erklärbar ist. Und inwieweit sich manche der hier vertretenen bildenden Künstler – wie etwa der Fotograf David LaChapelle, der Jackson in einem Triptychon voller biblischer Anspielungen als Heiligen stilisiert – auf beklemmende Art von der Hybris infizieren ließen.
So leicht wie David LaChapelle wird man es sich in der neuen Missbrauchsdebatte nicht machen dürfen. Den zitiert die Ausstellung angesichts der bereits früher erhobenen Vorwürfe mit den Worten: „Wir haben zehn Millionen Dollar ausgegeben, um ihn strafrechtlich zu verfolgen, während wir in Kalifornien kein Geld für Schulen haben.“
Eines allerdings überrascht bei der jetzt abermals aufflammenden Debatte nebst der dazugehörigen Boykottdiskussionen ohnehin: alle auch von der Justiz bereits behandelten Pädophilievorwürfe und Jacksons gelinde gesagt befremdliches Verhältnis zu Kindern sind seit Langem bekannt; spätestens in allen Nachrufen sind sie schon bei Jacksons Tod vor nun bald zehn Jahren thematisiert worden.
In Erklärungsnot geraten die Ausstellungsmacher jedoch ohnehin nicht. „We can’t rewrite History, but we can reframe it“, erläutert der aus London angereiste Kurator Nicholas Cullinan vor der Eröffnung treffend. Das ist ihm in jedem Fall gelungen, auch wenn die wahrlich komplizierte Gretchenfrage, wie weit man Künstler und Werk voneinander trennen kann, darf oder muss, weiter unbeantwortet bleibt. Man kann sie anhand von Michael Jackson und der Kunst der Popmusik stellen, die – wie der „Spiegel“ dieser Tage richtig festhielt – Werk, Person, Mode, Sprache, Haltung und Botschaft als eins betrachtet. Man kann sie ebenso gut aber auch anhand der Metoo-Debatte oder der Kulturboykottinitiativen gegenüber Israel durchexerzieren, und wenn man wollte auch – von Jörg Immendorff über Vladimir Nabokov bis Klaus Kinski – an konkreten anderen Protagonisten des Kulturbetriebs.
„Michael Jacksons Lebenswerk ist Kulturgeschichte, und wir können es uns nicht leisten, Kulturgeschichte auszuradieren“, setzt Rein Wolfs schließlich auch noch hinzu. Er will mit seinem Haus „nicht nur ästhetische, sondern auch moralisch-ethische Fragen stellen, denn das macht uns auch gesellschaftlich relevant“.
Dieses Ziel hat er mit Sicherheit erreicht. Über die buchstäbliche Kunstfigur Michael Jackson darf weiter nachgedacht werden. Wie auch über das Michelangelo-Zitat, das Jackson selbst für sich ins Feld geführt hat: „Der Schöpfer wird vergehen, aber sein Werk überleben.“