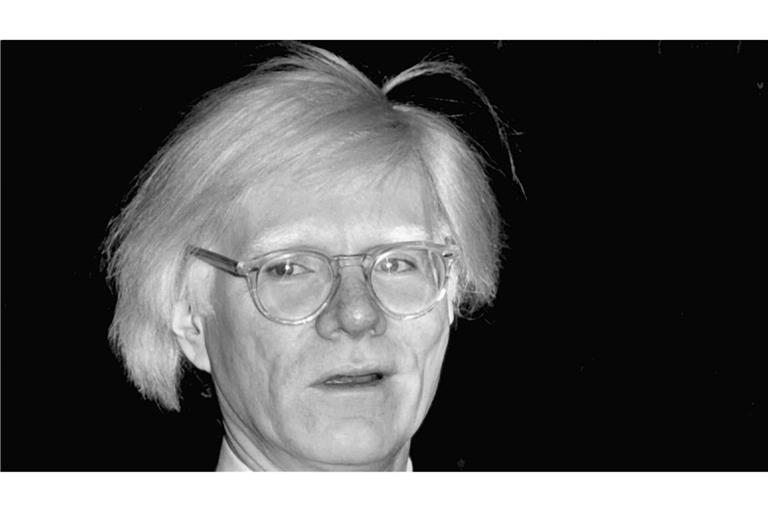Reza-Uraufführung in München
Viel Rauch, kein Feuer im neuen Stück der Star-Autorin
Opern- und Filmregisseur Philipp Stölzl bringt in München mit Yasmina Rezas „James Brown trug Lockenwickler“ das jüngste Stück der berühmtesten Dramatikerin der Welt zur Uraufführung. Lohnt der Besuch des Stücks über Identitätsfragen?

© Staatsschauspiel München/Sandra Then
Szene mit Rauch ausstoßendem Bühnenfisch, Vincent zur Linden als Jacob, Lisa Wagner als Psychiaterin, Michael Goldberg als Jacobs Vater (v. li.).
Von Nicole Golombek
Ein junger Mann, der sich einbildet, er sei die kanadische Sängerin Céline Dion. Und ein anderer, der weiß ist und sagt, er sei schwarz. Dazu Eltern, die damit ziemlich überfordert sind: Mit „James Brown trug Lockenwickler“ begibt sich Yasmina Reza, meistgespielte Gegenwartsautorin, ins Haifischbecken identitätspolitischer Debatten.
Sie kommt ohne Bisse zurück – dafür mit einer Forelle. Und zwar mit einer, die in zwei Stücke geteilt ist, scheinbar frei im Raum schwebt und höchstens mal eine Menge Rauch, nie aber Feuer spuckt in der Inszenierung von Regisseur und Bühnenbildner Philipp Stölzl am Freitag bei der Uraufführung am Bayerischen Staatsschauspiel München.
Der Fisch macht optisch etwas her, und er passt zu dem Thema des zweistündigen Abends. Eine der Eigenarten dieser Wesen ist es, dass die Färbung innerhalb ihrer Art variabel ist und sich im Lauf des Lebens ändern kann. So ergeht es eben auch Jacob, der als Céline Dion angesprochen werden möchte, und Philippe, der von sich sagt, er sei schwarz.
Die französische Dramatikerin ist damit berühmt geworden, ihre Figuren gern mal schlagfertig auch reaktionäre Ansichten formulieren und ideologische Kämpfe austragen zu lassen. Seien es künstlerische Fragen wie in „Kunst!“, seien es Fragen der Eheführung und Kindererziehung wie in dem Stück „Der Gott des Gemetzels“, das auch als Hollywoodkomödie funktionierte.
Keine Scharmützel allerdings bei diesem Stück, maximal leichte Verwirrtheitszustände allerseits. Die Eltern Lionel und Pascaline versuchen sich zu arrangieren, dass ihr „Muckel“ kein junger Mann mehr sein will. Die Psychiaterin in der Einrichtung, in der Jacob und Philippe leben, ist keine Ärztin, die versucht, eine „Krankheit“ zu heilen, sie moderiert und verteidigt die Identitätswechsel.
Aschenputtel – neu gedeutet
Sie hält dazu den Eltern, dem Publikum einen Vortrag über Menschen, die verzweifelt versuchen, gängigen Schönheitsidealen zu genügen. Als Beispiel wählt sie – selbst in ein Prinzessinnenkleid gewandet – Aschenputtel. Anders als gewöhnlich üblich schlägt ihr Herz für die als neidisch geltenden Stiefschwestern der Titelheldin, die sich Zehen und Fersen abhacken, um ins starr normierte Schuh-Schönheitsideal zu passen (sie führt das Abhacken entsprechend drastisch vor).
„Denken wir mal an die beiden Schwestern, die uns so viel ähnlicher sehen“, sagt sie, schwingt demonstrativ ihr Bein in die Höhe und vergleicht ihren Fuß mit dem Fußmodell der Schwestern. Sie verteidigt die Schwestern und „all die Unzähligen, die im falschen Körper auf die Welt gekommen sind“, plädiert dafür, „sich aus diesen schicksalhaften Umständen zu befreien“ und stattdessen vielmehr ihr Schicksal und Dasein selbst zu entwerfen.
Spannungsreiches Spiel
Entsprechend brüsk ist die Reaktion der Eltern. Pascaline: „Hast du verstanden, was sie gesagt hat?“ Lionel: „Nein. Aber gefallen hat es mir nicht.“ Und: „Was haben die zwei Weiber mit uns zu tun?“ – „Wer ist schon mit seinem Körper zufrieden?“ Sie können sich nicht vorstellen, ihren Jacob als Céline zu akzeptieren, doch viel mehr an Kritik erlauben sich Lionel und Pascaline nicht.
Die jungen Menschen wiederum ecken auch nicht weiter an, kritisieren weder Eltern noch Gesellschaft. Und in der nicht weiter spezifizierten „Klinik“ wird ihnen Freiheit gewährt – sie sind, wie sie sind. Wie sie im Alltag (über-)leben, wer von der „Klinik“ profitiert, warum sie überhaupt dort sind, ist kein Thema.
Lisa Wagner als Psychiaterin
Diese Statik der Figuren wiederum macht es für die Schauspieler Johannes Nussbaum als Philippe und Vincent zur Linden als Jacob/Céline schwer, ihre Figuren hinreichend interessant zu gestalten. Spannungsreich wird das Spiel, wenn die Psychiaterin und die Eltern aufeinandertreffen. Michael Goldberg als Lionel trägt ein graues Gesicht zum grauen Anzug, steht stocksteif neben seiner in duftiges Pastell gehüllten Gattin Pascaline (Juliane Köhler). Er amüsiert mit gequälter Miene, während sie ihre emotionale Überforderung zelebriert, beflissen verständnisvoll lächelt und hysterisch schreiend unter dem Anstaltsklavier kauert.
Dazu gibt’s konsternierte, ironische Seitenblicke von der Psychiaterin. Gespielt wird sie von Lisa Wagner, bekannt aus TV-Serien wie „Weißensee“ und als Kommissarin Heller aus einer ZDF-Krimireihe. Mit lässigem Hüftschwung dominiert sie die Szene als coole, leicht verpeilte Wissenschaftlerin.
Sehenswert ist der Abend, weil das Timing der Pointen perfekt funktioniert, und weil das Ensemble in einen sanft schwingenden Flow gerät, die Figuren ernst genommen werden und die Stimmung fein zwischen Heiterkeit und Melancholie changiert.
Dem Regisseur gelingt es zudem, den nach der Textlektüre ratlos zurücklassenden, abrupt wirkenden Schluss poetisch abgründig zu inszenieren. Ohne zu viel zu verraten: Jacob/Céline entschwindet auch im Wortsinn in andere Sphären, und ob dies als ein glückliches oder ein tragisches Finale zu deuten ist, bleibt im Vagen. Der Vorhang zu und viele Fragen offen – nicht das Schlechteste, was sich über einen Theaterabend sagen lässt.

© Sandra Then
Zwei in der Klinik: Philippe (Johannes Nussbaum, li.) meint, er sei schwarz, Jacob (Vincent zur Linden) hält sich für die Sängerin Céline Dion in Yasmina Rezas neuem Stück „James Brown trägt Lockenwickler“, uraufgeführt von Philipp Stölzl im Residenztheater München.

© Sandra Then
Jacob (Vincent zur Linden) schont als Céline Dion seine Stimme und inhaliert feuchte Luft.

© Sandra Then
Jacobs Eltern Lionel (Michael Goldberg) und Pascaline (Juliane Köhler) auf dem Weg in die Klinik. Damit der Sohn nicht den Eindruck hat, die Eltern seien bedrückt, erzählen sie sich vor den Besuchen Witze. Auf der Schaukel sitzt Jacobs Freund Philippe (Johannes Nussbaum).

© Sandra Then
Michael Goldberg als Jacobs Vater Lionel Hutner bleibt ratlos. Er kann nicht verstehen, warum sein Sohn lieber eine Sängerin wäre.

© Sandra Then
Juliane Köhler spielt Jacobs Mutter Pascaline Hutner. Sie versucht sich mit Jacobs Identitätswechsel anzufreunden, gerät aber öfter mal aus der Fassung.

© Sandra Then
Die Psychiaterin (Lisa Wagner) hält einen Vortrag über Menschen, die im falschen Körper leben und die verzweifelt versuchen, den gesellschaftlichen Normen zu genügen – und sich dafür sogar verstümmeln, so wie die Schwestern von Aschenputtel. Sie demonstriert das an zwei Fußmodellen samt Aschenputtel-Schuh.

© Sandra Then
Irgendwann hat Lionel Hutner (Michael Goldberg) genug von der verständnisvollen Psychiaterin (Lisa Wagner) und rastet aus, er will seinen Sohn Muckel nennen dürfen und nicht Céline.

© Sandra Then
Ensemble im Chaos: (Juliane Köhler, Vincent zur Linden, Michael Goldbefrg, Lisa Wagner, Johannes Nussbaum, v. li.). Jeder bleibt bei seinen Positionen in dem Stück der französischen Autorin. Die Lockenwickler im Haar von Jacob bringen übrigens die Eltern dazu, über Lockenwickler zu sprechen, die der Sänger James Brown scheinbar trug – daher der Titel des Stücks „James Brown trug Lockenwickler“.