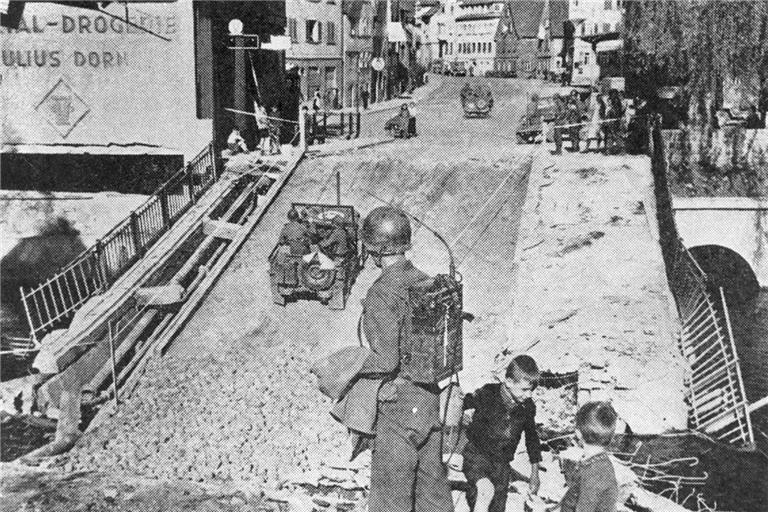Co-abhängig: Mitgefangen in der Sucht
Angehörige alkoholkranker Menschen leiden im Verborgenen – „Oft bleibt man dabei selbst auf der Strecke“
Was tun, wenn ein Angehöriger alkoholabhängig ist? Wie geht man mit der Sucht um und wie hilft man sich selbst? Wir haben zwei Frauen getroffen, die offen über die Alkoholabhängigkeit ihrer Partner sprechen – und darüber, wie sie selbst damit klarkommen.

© dima_sidelnikov - stock.adobe.co
Wenn der Partner ein Alkoholproblem hat, kann der Angehörige meistens nicht helfen. Foto: Fotolia/dima_sidelniko
Von Silke Latzel
BACKNANG. Wenn der Partner oder die Eltern alkoholkrank sind, leiden nicht nur sie selbst unter der Sucht. Es sind auch die Angehörigen, die mit dieser Krankheit umgehen müssen – manche schaffen es, andere nicht. Die Ehepartner von Frau G. und Frau S. (Namen sind der Redaktion bekannt) sind Alkoholiker. Trocken mittlerweile. Aber bis dahin war es nicht nur für die Männer ein harter Weg, sondern auch für ihre Frauen und Kinder. „Eigentlich ist die Sucht für die Angehörigen schlimmer als für die Abhängigen selbst. Denn der Abhängige schießt sich weg, während man selbst nüchtern ist und den Zustand des Partners ertragen muss.“ Frau G. spricht mit ruhiger Stimme. Heute kann sie das. „Es ist wie das Leben mit Doktor Jekyll und Mister Hyde – man weiß nie, wie der Partner sich im nächsten Moment verhalten wird. Er wird zu einem Fremden, verändert sich über die Jahre des Alkoholkonsums.“ G. hat immer versucht, den Alltag normal aufrechtzuerhalten, gerade auch für ihre Tochter. Das hat sie sehr viel Kraft gekostet, die ihr für ihr eigenes Leben fehlte. „Es fühlt sich an, als lebt man in einem Erdbebengebiet. Man weiß einfach nie, wann wieder etwas passiert, wenn er das nächste Mal trinkt, und wie er dann reagiert.“ Immer hat sie Plan A, B und C in der Tasche: „A tritt ein, wenn er nüchtern ist, B, wenn er in eine Situation gerät, in der er trinken könnte, und C, wenn er getrunken hat. Man bleibt dabei selbst einfach auf der Strecke und ist der Sucht hilflos ausgesetzt. Ich wollte meinem Mann immer helfen und habe dann gemerkt, dass ich es nicht kann. Das tut schon sehr weh.“
Frau G. saß auf gepackten Koffern, bereit, ihren Mann zu verlassen
Frau S. ist mit ihrem heutigen Wissen davon überzeugt, dass sie ihren Mann schon als Alkoholiker kennengelernt hat, auch wenn es damals nicht offensichtlich war. „Er hat nie den Alkohol einfach in sich reingeschüttet, immer nur viel Bier. Und lange Zeit habe ich da auch gar nicht drüber nachgedacht.“ Ihr Mann arbeitet im Schichtdienst, sie selbst manchmal ebenfalls bis zu 50 Stunden die Woche. Gemeinsame Zeit bleibt kaum. S. kümmerte sich um die Kinder, so war es schon immer, „für die Kinder ist die Mama zuständig. Manchmal haben sie ihren Vater eine ganze Woche nicht gesehen. Wie wir das damals geschafft haben und wie lange es noch gut gegangen wäre, kann ich heute gar nicht sagen. Ich habe zur der Zeit ja auch nie mit jemandem drüber gesprochen, auch wenn ich denke, dass mein Schwiegervater auch Alkoholiker war, das wurde immer alles schön unter dem Teppich gehalten.“ Ein kalter Entzug daheim bringt ihren Mann schließlich vom Alkohol weg.
Für die beiden Frauen hat sich durch die Sucht ihrer Partner auch das eigene Verhalten zum Alkohol geändert. „Früher haben mein Mann und ich eigentlich jeden Freitag nach Feierabend eine Flasche Sekt zusammen getrunken“, erzählt G. „Die Leichtigkeit, mit der ich das Thema Alkohol betrachtet habe, die ist einfach weg. Es ist eben nicht nur das lachende Partygesicht, das durch einen Rausch ausgelöst werden kann. Es ist auch eine hässliche Fratze. Und wenn man die einmal gesehen hat, kann man sie nicht mehr vergessen.“ Sie geht mit anderen Augen durch den Alltag, ihr fallen viel häufiger Menschen auf, die schon morgens betrunken sind. Außerdem macht G. sich vor allem Sorgen um ihre 16-jährige Tochter. „Da gehen bei mir ganz schnell die Alarmglocken an, wenn sie beispielsweise mit ihren Freunden feiern geht.“
„Das ganze Feiern hat sich bei uns verändert,“ bestätigt auch S. „Etwa bei Festen. Da merkt man, dass viele Leute einfach nur da sind, um trinken zu können. Und da hat man dann keine Lust mehr, mitzumachen. Und wenn ich heute beispielsweise Wein trinken möchte, dann kaufe ich nur ein kleine Flasche, die für zwei Gläser reicht. Mehr nicht.“ Auch S. hat zwei Kinder, heute 27 und 28 Jahre alt. Sie hat Angst, dass die Alkoholkrankheit ihres Mannes und ihres Schwiegervaters familiär bedingt ist – und ihre Kinder vielleicht auch irgendwann damit selbst konfrontiert sind. „Süchtig werden kann man in jedem Alter. Manchmal auch erst mit Beginn der Rente. Man ist davor nie sicher“, sagt sie.
Jahrelang sei G. auf gepackten Koffern gesessen, hatte den Schlüssel eines Hauses ihrer Kirchengemeinde in der Tasche, bereit, auszuziehen und ihren Mann zu verlassen, erzählt sie. „Meine Tochter hat mich, als sie alt genug war, es zu verstehen, auch immer wieder gefragt, wieso ich den Papa nicht verlasse. Und gleichzeitig aber gesagt, dass sie dann bei ihm bleiben würde. Sie liebt ihren Vater über alles. Aber ich konnte sie ja nicht allein bei ihm lassen.“ G. entscheidet sich dafür, zu bleiben. Sie liest viel zum Thema Sucht, findet für ihre Familie professionelle Hilfe bei einer Psychologin und geht zu Selbsthilfegruppen.
Darüber zu sprechen ist schwer, viele schämen sich
„Darüber zu sprechen, in einem geschützten Raum mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, das ist sehr wichtig.“ Doch es kostet auch große Überwindung. Denn hört man heute das Wort „Alkoholiker“, denken viele Menschen noch immer an Betrunkene, die auf einer Parkbank liegen. Die wenigsten Alkoholkranken passen in dieses Bild, doch das Stigma, das ihnen anhaftet, ist auch für die Angehörigen ein Problem und macht es für sie schwer, offen darüber zu sprechen – zu groß ist die Scham. „Und man will ja seinem Partner gegenüber auch nicht illoyal sein“, so G.
Für die beiden Frauen besonders schwer: Sie wollen ihren Partnern helfen – können es aber nicht. „War er nüchtern, konnten wir nie darüber sprechen. Also habe ich es irgendwann gelassen“, so G. Sie zieht die Konsequenz, nicht mehr mit ihm zu reden, wenn er betrunken ist. Stattdessen kauft sie ein Atemalkoholmessgerät und lässt ihn immer dann „pusten“, wenn er sagt, er sei nüchtern. „Das Ergebnis war für ihn selbst dann immer ein richtiger Schock, auch wenn er ja eigentlich wusste, dass er getrunken hat. Da habe ich dann gemerkt, es war nicht er, der mich angelogen hat, es war seine Krankheit. Und das hat mir viel Freiheit ins Herz gegeben.“ S. und G. wissen heute, dass sie in ihrer Situation nicht gefangen waren und sich hätten dafür entscheiden können, zu gehen – und das auch jetzt immer noch tun können, wenn ihre Männer wieder rückfällig werden.
Aber diese Erkenntnis zu gewinnen, war für beide ein langer Prozess. Wichtig ist ihnen, zu sagen, dass Betroffene dem Partner nichts „androhen“ sollen, was sie nicht bereit sind, auch in die Tat umzusetzen. Das heißt: „Ich kann nicht sagen: ,Wenn du das nächste Mal trinkst, dann gehe ich‘, und dann passiert es und ich bleibe. Dann merkt er ja, dass es gar nicht ernst gemeint ist“, so G. „Ebenso wichtig: Nach sich selbst schauen. Nicht darauf zu warten, bis der Süchtige sich um seine Sucht kümmert. Denn nicht nur er leidet, sondern der Angehörige auch. Und man muss sich selbst helfen.“
Eine anonyme Selbsthilfegruppe für Angehörige von Suchtkranken gibt es etwa beim Kreuzbund Backnang. Sie treffen sich jeden vierten Montag im Monat, immer von 19.30 bis 21 Uhr in der Albertstraße 8. Das nächste Treffen findet übermorgen statt. Ansprechpartnerin is Claudia Kuhn unter Telefon 0160/96726673.
In den beiden Selbsthilfegruppen der anonymen Suchtkranken sind Angehörige willkommen. Diese treffen sich ebenfalls in der Albertstraße, donnerstags von 20 bis 22 Uhr und freitags von 18 bis 20 Uhr.