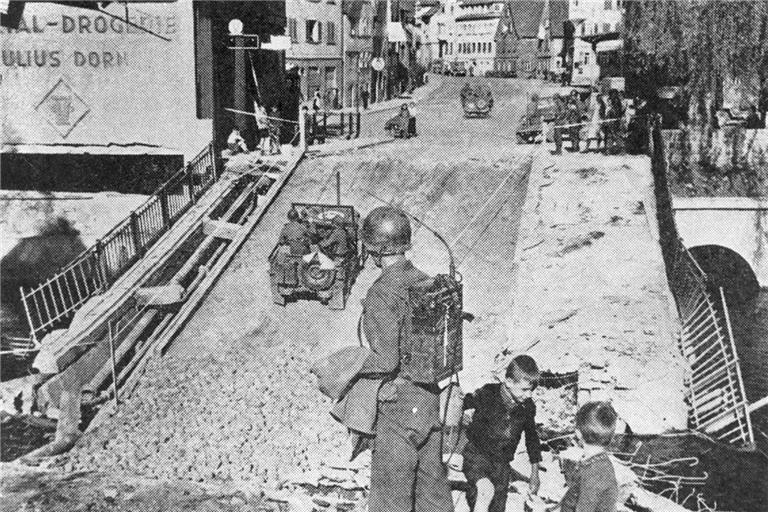Forstbetriebsgemeinschaft Weissacher Tal: Alte Bäume sicher fällen
Die Veranstaltung der Forstbetriebsgemeinschaft Weissacher Tal und der SVLFG zum Thema Sicherheitsfälltechnik stößt im Wald zwischen Sechselberg und Rottmannsberg bei 70 Privatwaldbesitzern sowie bei Mitarbeitern der Bauhöfe und Feuerwehren auf reges Interesse.

© Ute Gruber
Die Experten der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft vermitteln die neuesten Erkenntnisse zur sicheren Baumfällung. Fotos: Ute Gruber
Von Ute Gruber
Rems-Murr. Ungewohnt farbenfroh ist heute der triste Winterwald: Scharen von gestandenen Männern in signalroter und gelber Schutzkleidung bevölkern den Laubwald auf der Kuppe zwischen Sechselberg und Rottmannsberg, eine Quotenfrau ist auch dabei. Sie ist die Sicherheitsbeauftragte der Stadt Esslingen und wie die Waldbesitzer nutzt sie heute die Gelegenheit, sich von den Experten der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (SVLFG) die neuesten Erkenntnisse zur sicheren Fällung von absterbenden Bäumen – sogenanntem Schadholz – in der Praxis zeigen zu lassen.
Das Thema ist hochbrisant, denn nach den vielen Dürresommern in den letzten fünf Jahren stehen auch die Wälder im Rems-Murr-Kreis voll mit absterbenden Buchen, Fichten und Tannen. „Bei den langfaserigen Fichten ist das weit weniger kritisch, obwohl diese viel häufiger betroffen sind“, erläutert Präventionsbeauftragter Jochen Baumgart. „Gefährlich ist das aber besonders bei Laubholz und auch Tanne. Deren kurze Holzfasern werden während des Absterbens sofort mürbe und dann genügen kleinste Erschütterungen am Stamm – zum Beispiel beim Einklopfen des Metallkeils – und es kommen ganze Äste runter.“ Da nützt dann auch der Helm nichts mehr.
Zwei Männer sind im vergangenen Jahr im Rems-Murr-Kreis beim Baumfällen ums Leben gekommen, mindestens zwei weitere im benachbarten Ostalbkreis. Der Schwäbische Wald mit seinen Unmengen an Kleinwaldbesitzern mag hier besonders gefährdet sein, weil der Forst hier meist nur nebenher bearbeitet wird. „Das sind dann oft Familienväter im besten Alter, häufig mit landwirtschaftlichem Betrieb daheim. Eine Tragödie für die zurückbleibende Familie.“
Außerhalb des kritischen Bereichs dank elektrischen Fällkeils und Windeneinsatzes
Offenbar ist das Thema bei den aktiven Waldbesitzern inzwischen angekommen, denn die theoretischen und praktischen Schulungen, welche die Waldbauernvereine, also die Forstbetriebsgemeinschaften (FBG), in den vergangenen Monaten im Umkreis angeboten haben, sind sehr gut besucht: „Ich hatte zuletzt fast 70 Anmeldungen“, freut sich Gerhard Ellinger von der FBG Weissacher Tal, der die Veranstaltung für seine FBG organisiert hat, „dabei lief es am Anfang sehr schleppend.“ Fast 70 Teilnehmer bei rund 150 FBG-Mitgliedern – das spricht für sich.
Zwei Methoden zur sicheren Fällung werden am vergangenen Freitag angesprochen und vorgeführt: Der ferngesteuerte Fällkeil und die Unterstützung mit Schlepper und Seilwinde. „Beide Techniken ermöglichen, dass wir uns außerhalb der Reichweite herabfallender Äste befinden“, erklärt Marc Schell von der SVLFG, der als gut ausgebildeter Forsttechniker mit langjähriger Erfahrung bundesweit Praxisanleitungen gibt.
Als dritte Möglichkeit käme natürlich die vollmechanisierte Fällung mit dem Vollernter in Betracht. Selbige wäre mit 0,2 Prozent der Unfälle laut Baumgart zwar die sicherste, aber für den Waldbesitzer auch die teuerste Variante und setzt zudem eine gute Zugänglichkeit der Fläche voraus. Diese ist im wildromantischen Schwäbischen Wald oft nicht gegeben.
Der Kronbereich muss begutachtet werden
„An erster Stelle steht die Baumansprache“, beginnt der Forstprofi neben dem ersten ausgewählten Kandidaten, einer halbdürren Buche. Gemeint ist damit eine möglichst genaue Einschätzung der Gegebenheiten. Die Höhe etwa – 30 bis 35 Meter schätzen die umstehenden Waldbesitzer. Schell schätzt etwa 40 Meter. „Was bedeutet: ein Gefahrenbereich von doppelter Baumlänge in alle Richtungen, der abzusichern ist. Also 160 Meter Durchmesser.“
Danach wird der Kronenbereich begutachtet: Gibt es Totäste? Neigt der Baum sich auf eine Seite? Entsprechend ist die Wurfrichtung und die Technik zu wählen. Und ist die Basis gesund? „Auf keinen Fall den Schnitt in modriges Holz setzen, die Bruchkante würde nicht halten – das ist brandgefährlich. Lieber Holz verschenken und weiter oben ansetzen.“ Und wie sieht das Umfeld aus? „Von der dürren Eiche da kann auch was runterfallen, wenn die gestreift wird.“
Gemeinsam einigt man sich auf Fällrichtung und Schnittsetzung. Jetzt wirft Forstprofi Schell die Kettensäge an, mit vielfältigen Klicken schließen die Zuschauer ihren Gehörschutz. „Aaachtung!“ ertönt der vorschriftsmäßige, erste Ruf bei der Setzung des Fällkerbs. Kurz darauf wird der neuartige Keil eingesetzt und alle entfernen sich aus der Gefahrenzone.
Mit leisem Knattern spreizt der akkubetriebene Keil auf, unter schwerem Ächzen neigt sich die kranke Buche in die gewünschte Richtung und donnert unter einem Gewitter an auseinanderspritzenden Holzteilen zu Boden. Ungeheure Kräfte sind hier am Wirken – noch minutenlang schwingen die gestreiften Nachbarbäume nach. „Erst warten, bis die sich beruhigt haben!“ Vorsicht ist wichtig.
Sicherer ist der ferngesteuerte Fällkeil
Sicherer, aber in der Anschaffung auch teurer als der ferngesteuerte Fällkeil, der zwischen 2.700 und 6.000 Euro kostet, ist die Fällung mit Unterstützung von Schlepper und Forst-Seilwinde. Letztere können sich aber Mitglieder von der FBG gegen Entgelt ausleihen. Der Fachmann führt vor, wie das umschließende, leicht gespannte Seil mittels Teleskop-Schüttelhaken weit am Stamm nach oben geschoben wird, dann werden die nötigen Schnitte gesägt. „Aaachtung!“ Knarzend zieht die ferngesteuerte Winde an und der Baum fällt wunschgemäß zu Boden.
Gestandene Praktiker aus der Gegend, darunter auch Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr und des Bauhofs, die ja immer wieder Straßen oder Gleise von Sturmholz zu befreien haben, fachsimpeln am Baumstumpen und diskutieren die vorgestellte Sicherheitsfälltechnik. „Da hätt mer jetzt früher direkt durchgsägt“, weist einer auf eine Holzstruktur, „aber da stehst dann halt direkt daneben.“ Das Gefahrenbewusstsein hat deutlich zugenommen. „Wenn du so einen Fall nur alle zwei Jahre hast…“, schüttelt ein anderer den Kopf. „Also ich frag da mein Spezi, der macht des täglich. Wenn’s dann liegt, kann ich selber weitermachen.“
Präventionsbeauftragter Baumgart, der nach jedem Unfall vor Ort ist und für die Berufsgenossenschaft Unfallhergang und -ursache analysiert, freut sich über die positive Resonanz der Waldbesitzer: „Die Leute sind zugänglicher, selbstkritischer geworden. Es gibt einen guten Austausch mit den Forstbetriebsgemeinschaften, besonders hier in der Gegend.“ Er sagt: „Das Image der BG als lästige Bauernpolizei hat sich gewandelt, zumindest in diesem Bereich.“ Und dann gibt er den Teilnehmern einen lockeren Spruch mit auf den Weg: „Lieber eine Sekunde feige als ein Leben lang tot!“
Forstbetriebsgemeinschaft Die FBG ist ein Verein aus privaten (und auch kommunalen) Waldbesitzern, die gemeinsam ihr Holz vermarkten, Verbrauchsmaterial und Maschinen anschaffen, sich fortbilden, Fördermittel einwerben und auch in der Öffentlichkeit auftreten. Im Rems-Murr-Kreis gibt es derzeit vier FBGs, welche die hiesigen Waldgebiete abdecken: FBG Welzheimer Wald, FBG Murrhardt, FBG Murr-Lauter und FBG Weissacher Tal und Umgebung.
FBG-Mitglied Jeder Waldbesitzende kann Mitglied werden. Nähere Informationen gibt es über das Kreisforstamt in Backnang oder über die gemeinsame Homepage https://www.fbg-schwaebischer-wald.de (außer FBG Murrhardt).
Versicherung Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau (SVLFG) hat deutschlandweit knapp 1,5 Millionen Versicherte und deckt neben Kranken-, Alters- und Pflegeversicherung über die Berufsgenossenschaft auch das Unfallrisiko in der grünen Branche ab. Von den knapp 130.000 Arbeitsunfällen, welche der SVLFG pro Jahr gemeldet werden, passieren knapp 7 Prozent im Forst. Allerdings waren darunter 26 tödliche Arbeitsunfälle, somit hatte jeder vierte, der ums Leben kam, gerade im Forst gearbeitet. Und dies, obwohl Forstbetriebe nur vier Prozent der SVLFG-Mitglieder ausmachen. „Ein kleiner Haufen mit großem Unfallaufkommen“, sagt Präventionsbeauftragter Jochen Baumgart.