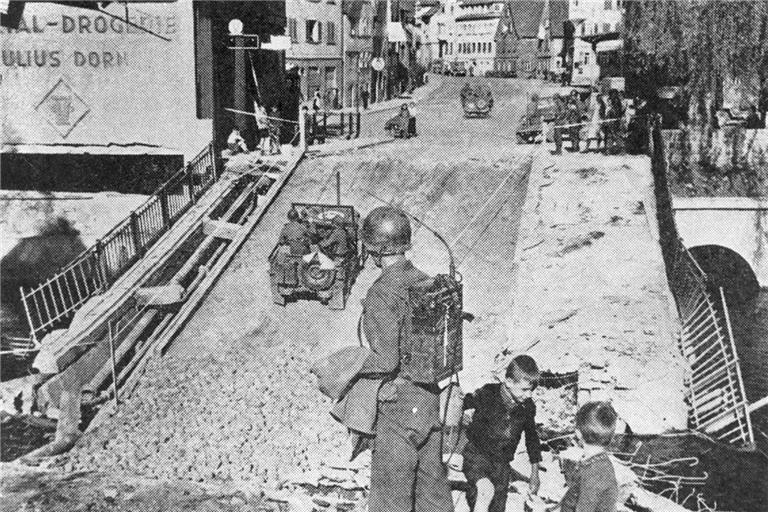Schüler in Backnang lehnen Deutschpflicht ab
Der Generalsekretär der CDU, Mario Czaja, hat eine Diskussion losgetreten: Sollte auf den Pausenhöfen von Schulen möglichst nur Deutsch gesprochen werden? Backnanger Schulleiter und Schüler äußern sich dazu.

© Alexander Becher
Jasmeen (von links), Mohammad, Kovan, Selina, Malin, Subhan und Lana tauschen sich über den Vorschlag von Mario Czaja aus. Foto: Alexander Becher
Von Anja La Roche
Backnang. „Es geht nicht, dass auf den Schulhöfen andere Sprachen als Deutsch gesprochen werden.“ Das hat Mario Czaja, Generalsekretär der CDU, kürzlich in einem Interview mit der Zeitung Die Welt gesagt. Er plädiert dafür, dass pädagogische Fachkräfte die Schüler nicht nur während des Unterrichts, sondern auch in der Pause darauf hinweisen, keine anderen Sprachen als Deutsch zu sprechen. Sonst würden schon in der Schule Parallelgesellschaften entstehen, so der Politiker. Was sagen Backnanger Schüler und Schulleiter zu den Äußerungen des Christdemokraten?
Um das Thema zu besprechen, hat sich eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Mörike-Gemeinschaftsschule im Alter von 15 und 16 Jahren mit unserer Zeitung zusammengefunden. Sie alle finden: Ein Verbot für andere Sprachen auf dem Pausenhof sollte es nicht geben. „Das hat ja auch etwas mit Freiheit zu tun“, sagt Mohammad. Seine Muttersprache ist Kurdisch, aber in der Schule, sagt er, spreche er immer Deutsch. „Ich finde Deutsch besser, damit ich es besser lerne.“ Aber für die Leute, die das nicht machen möchten, sollte es kein Verbot geben, findet er.
Im Unterricht gibt es schon genügend Hürden, sagt eine Schülerin
Lana, die neben Deutsch auch Arabisch und Kurdisch spricht, findet außerdem, dass man als Schülerin, die erst noch Deutsch lernt, schon im Unterricht mit genügend Hürden zu kämpfen hat. „Man traut sich oft nicht, sich zu melden, weil man oft ausgelacht wird, wenn man sich nicht perfekt ausdrückt“, sagt sie.
Subhan ist in Afghanistan geboren und seine Muttersprache ist Dari. In der Grundschule sei er durchaus auch mal in der Pause darauf hingewiesen worden, sich nicht in seiner Muttersprache zu unterhalten, obwohl er noch kein Deutsch konnte. „Ich fand das komisch“, sagt er.
Andererseits findet er es auch wichtig, dass die Kinder viel Deutsch sprechen und so die Sprache schnell lernen. Die Vorbereitungsklasse habe ihm dabei viel geholfen, erzählt er. In diese kommen Kinder, die noch kein oder nur sehr wenig Deutsch können, bevor sie in den regulären Unterricht integriert werden.
Eine Schülerin denkt auch an die,die noch fast gar kein Deutsch können
„Wenn man hier wohnt, lernt man sowieso die Sprache“, sagt Jasmeen, die seit vier Jahren in Deutschland wohnt. Wenn die 15-jährige Schülerin sich auf ihrer Muttersprache Punjabi oder auf ihrer Zweitsprache Italienisch unterhält, gebe ihr das aber ein „gutes Familiengefühl“, wie sie erklärt. Sie denkt außerdem an die Kinder, die gerade erst nach Deutschland gekommen sind. „Die können gar nicht anders als sich in ihrer Sprache zu unterhalten“, sagt sie.
Für eine 16-jährige Schülerin, die ihren Namen nicht nennen möchte, gehört es zum Schulalltag dazu, sich auch mal auf Türkisch zu unterhalten. „Ich kann mich auf Türkisch besser mit Freunden verstehen“, sagt sie. Für sie wäre es so, als würde ihr ein Stück ihrer Identität genommen, wenn sie das in ihrer freien Zeit, also in der Pause, nicht machen dürfte. Für sie und die anderen Jugendlichen ist es zudem wichtig, die Muttersprache im Alltag zu verwenden, um sie nicht zu verlernen. „Ich rede sonst ja nur zu Hause Türkisch“, erklärt sie.
Malin und Selina interessieren sich ebenfalls für das Thema und haben sich dem Gespräch angeschlossen. Denn auch wenn die beiden Schülerinnen keinen Migrationshintergrund haben, sind die vielen verschiedenen Sprachen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler Teil ihrer täglichen Lebensrealität. „Wenn jemand neu ist, sollte man die Sprache schon fördern“, sagt Malin. „Aber ich finde, man sollte keine Regel einführen.“ Selina schlägt denjenigen vor, die ihr Deutsch in der Pause verbessern, aber auch ihre Muttersprache weiter sprechen wollen, das Gesagte in beiden Sprachen – und dadurch für alle verständlich – zu wiederholen.
Wenn sich Mitschüler ausgeschlossen fühlen
Was die Gruppe kritisch sieht: Wenn sich Mitschüler in einer anderen Sprache unterhalten und sie sich neben ihnen ausgeschlossen fühlen. „Dann kann man sich gar nicht unterhalten“, sagt Malin. „Wenn die mich angucken und reden, dann fände ich es blöd, weil ich denke, die lästern über mich“, sagt Subhan. Für die Jugendlichen gehört es zum normalen Umgangston dazu, einzelne Personen nicht aus Unterhaltungen auszugrenzen.
Zwei Backnanger Schulleiterinnen haben noch mal einen anderen Blickwinkel auf die Aussage des CDU-Politikers. „Das kann nur jemand sagen, der die schulische Realität nicht kennt“, sagt Karin Moll, Schulleiterin der Mörike-Gemeinschaftsschule. „Und auch nicht genug über Sprache weiß“, setzt sie hinzu. Es sei nachgewiesen, dass Kinder, die ihre Muttersprache gut beherrschen, auch besser neue Sprachen lernen. Das sowieso schon knappe Schulpersonal mit der Aufgabe zu belasten, die Schülerinnen und Schüler in der Pause zum Deutschsprechen anzuhalten, hält sie für falsch – und für schlicht nicht leistbar. Aktuell haben 169 von 259 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe einen Migrationshintergrund.
In der Pause sollen sich die Schülerinnen und Schüler auch mal erholen dürfen
Die Schulleiterin der Plaisirschule sieht das ähnlich. „Ich denke, es ist wichtig, dass die Kinder im Unterricht Deutsch sprechen. In der Pause würde ich das nicht kontrollieren wollen.“ Die Schülerinnen und Schüler, die noch nicht so gut Deutsch können, sollten sich in der Pause auch mal erholen dürfen.
„Ich denke, die Kinder bemühen sich generell, Deutsch zu sprechen“, sagt Christine Nagel. Denn ihre Motivation, am sozialen Miteinander teilzuhaben, sei groß. „Das tut dem keinen Abbruch, wenn die Kinder sich in der Pause mal in ihrer eigenen Sprache unterhalten.“ Es sei wichtig, die Mehrsprachigkeit als etwas Positives zu sehen und das den Kindern und Jugendlichen auch so zu vermitteln.
Eine bessere Sprachförderung ist für die beiden Schulleiterinnen trotzdem enorm wichtig. „Das hat auch etwas mit Bildungsgerechtigkeit zu tun“, sagt Karin Moll. Jedes Frühjahr muss sie dem Kultusministerium melden, wie viele Kinder Sprachförderbedarf haben. Trotzdem bietet ihre Schule nicht die Menge an Vorbereitungsklassen und Sprachförderstunden an, die eigentlich notwendig wären. Das liege am Personalmangel, erklärt Moll. „Ich wünsche mir schon lange, dass der Beruf des Lehrers vom Landeskultusministerium mehr beworben wird.“